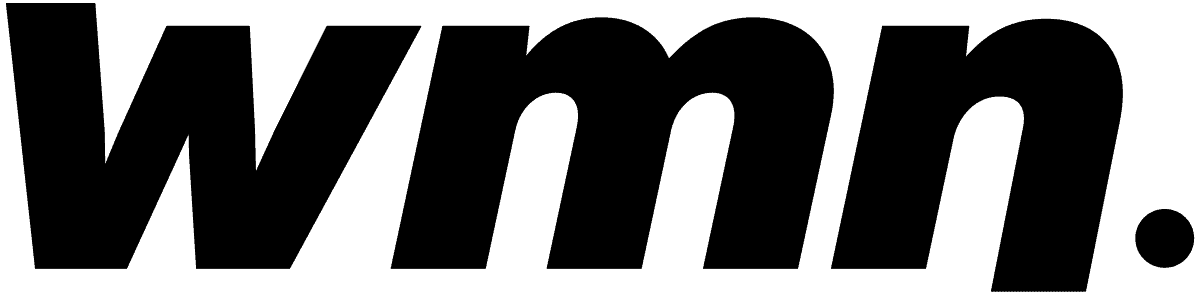30 Tage klangen für mich harmlos. Ein Monat, vier Wochen, ein winziger Abschnitt im großen Ganzen. Und dann kam es plötzlich ganz Dicke: Ich habe 30 Tage lang täglich eine halbe Stunde meditiert – und das hat mehr in mir bewegt, als ich je für möglich gehalten hätte.
Was ich erwartet hatte? Vielleicht ein bisschen mehr Gelassenheit, vielleicht besseren Schlaf. Was ich bekommen habe? Eine emotionale Achterbahnfahrt, einen Blick in Abgründe – und am Ende das Gefühl, endlich fliegen zu können.
Lesetipp: Diese Sitzhilfen machen deine Meditation sofort bequemer
Inhaltsverzeichnis
Warum ich überhaupt mit Meditation angefangen habe
Es war dieser Moment, an dem ich merkte: Ich funktioniere nur noch. Gedanken im Dauerloop, ein Körper, der müde, aber rastlos war, und ein leiser innerer Ruf nach Stille. Ich wollte nicht mehr davonrennen, sondern einfach mal stehen bleiben. Und hören, was da wirklich in mir vorgeht.
Meditation klang logisch. Vielleicht würde es helfen, den Kopf leiser zu drehen. Vielleicht würde ich mich endlich wieder spüren. Aber ehrlich? Ich war skeptisch. Ich hatte schon so oft versucht, „regelmäßig zu meditieren“. Immer wieder aufgegeben. Zu langweilig. Zu anstrengend. Zu unbequem. Diesmal sollte es anders sein – 30 Tage lang. Ohne Ausrede.

Damit es nicht zu langweilig wird, habe ich mich vorher über verschiedene Arten von Meditation informiert. Mehr dazu liest du hier: Arten von Meditation: So spannend kann deine Praxis sein
Die ersten Tage: Euphorie trifft Widerstand
Anfangs war ich motiviert. Ich richtete mir einen kleinen Meditationsplatz ein, suchte mir eine App aus und setzte mich voller Hoffnung hin. Tag eins, Tag zwei – gar nicht so schwer, dachte ich. Ich fühlte mich ruhig und irgendwie stolz.
Aber ab Tag drei kamen sie: die Stimmen im Kopf. Der Widerstand im Körper. Das unaufhörliche „Was bringt das hier eigentlich?“. Ich konnte kaum fünf Minuten stillsitzen, ohne mich wie auf Nadeln zu fühlen. Mein Geist war unruhig. Gedanken sprangen von Einkaufsliste zu Selbstkritik, von Zukunftsängsten zu banalen Erinnerungen. Ich war frustriert – und noch lange nicht erleuchtet.
Woche zwei: Alte Wunden brechen auf
Und dann wurde es still. So still, dass ich plötzlich Dinge hörte, die ich lange weggeschoben hatte. Da war Traurigkeit. Scham. Ein alter Schmerz, den ich nicht mal benennen konnte. Ich saß da, atmete – und heulte.
Es war erschreckend. Ich hatte mit Entspannung gerechnet, nicht mit emotionaler Lawine. Und gleichzeitig spürte ich: Das ist wichtig. Ich begann, diese Gefühle nicht mehr wegzudrücken. Sie einfach da sein zu lassen. Das tat weh. Und es war heilsam.
Manche Tage fühlten sich an wie innere Operationen ohne Narkose. Ich zweifelte, ob ich weitermachen sollte. Aber etwas in mir wollte verstehen. Und dableiben.
Woche drei: Akzeptieren, was ist
Langsam – ganz langsam – veränderte sich etwas. Ich hörte auf, gegen die Gedanken zu kämpfen. Ich begann, sie zu beobachten. Einfach da zu sein. Nichts wegmachen zu wollen.
Es gab Momente, in denen plötzlich alles ruhig wurde. Nur für Sekunden – aber sie fühlten sich wie ein Zuhause an, das ich lange vergessen hatte. Ich wurde weicher mit mir selbst. Freundlicher. Und inmitten der chaotischen Gedanken fand ich manchmal eine kleine Pause. Eine stille Lücke. Und das war genug.
Auch körperlich spürte ich Veränderungen: Ich atmete tiefer. Meine Schultern waren nicht mehr ständig oben. Mein Gesicht entspannte sich. Ich war noch lange nicht „zen“ – aber ich war auf dem Weg.
Woche vier: Der Schmetterling im Bauch
In der letzten Woche wurde etwas in mir leichter. Nicht immer, nicht dauerhaft – aber spürbar. Mein Kopf war immer noch voll, aber ich hatte gelernt, nicht alles darin so ernst zu nehmen. Ich konnte Gedanken kommen und gehen lassen. Und ich war überrascht, wie oft sie einfach gingen, wenn ich sie nicht festhielt.
Ich fühlte mich freier. Mein Fokus wurde klarer. Ich traf bessere Entscheidungen, weil ich nicht mehr aus dem Autopilot heraus reagierte. Ich spürte wieder mehr Verbindung zu mir selbst – und traf plötzlich Entscheidungen für mein Leben, bei denen ich es niemals für möglich gehalten hätte, dass ich sie je treffen könnte.
Fazit: Was bleibt nach 30 Tagen Meditation?
Ich bin nicht erleuchtet. Ich bin nicht immer ruhig. Aber ich bin ehrlich mit mir selbst geworden. Und das ist das größte Geschenk dieser 30 Tage. Meditation hat mich nicht in eine bessere Version von mir verwandelt. Sie hat mich meine ECHTEN körperlichen und emotionalen Bedürfnisse hören lassen.
Ich meditiere weiter. Nicht, weil ich „muss“, sondern weil ich will. Weil ich diese Stille plötzlich liebe, in der alles auftaucht – und alles gut sein darf. Wenn du das liest und denkst: „Ich weiß nicht, ob ich das kann“ – glaub mir, ich wusste es auch nicht. Aber genau das ist der Weg. Du musst nicht gut sein. Du musst nur da sein. Alles andere kommt. Und manchmal bringt es Flügel mit.