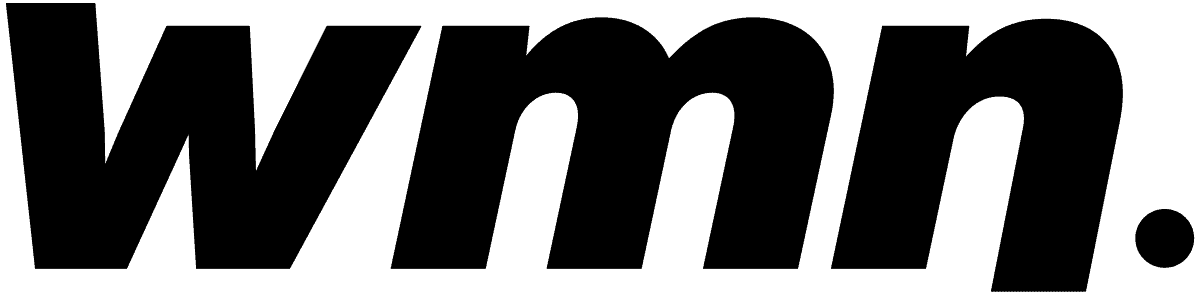Das sogenannte Ehegattensplitting spaltet die Politik schon seit einiger Zeit. Was ursprünglich als Möglichkeit der Steuerersparnis für Paare gedacht war, sorgt heute dafür, dass einige Menschen sogar mehr Steuern zahlen müssen. Wie genau ein Aus des Ehegattensplittings die Zukunft beeinflussen könnte, verraten wir dir in diesem Artikel.
Alles zum „Aus des Ehegattensplittings“:
Was ist das Ehegattensplitting?
Das Ehegattensplitting existiert bereits seit 1958. Damals galt es als besonders fortschrittliche Lösung, um das zu versteuernde Einkommen von Ehepaaren zu berechnen. Heute existiert es noch immer.
Dabei zahlt jedoch nicht jede*r Ehepartner*in selbst einen Teil der Einkommenssteuer, sondern es wird ein gemeinsames zu versteuernden Einkommen berechnet. Dazu werden die Einkommen beider Eheleute zusammengerechnet und anschließend halbiert. Jetzt wird für diese Summe die Einkommenssteuer berechnet und der dabei herauskommende Betrag nochmal verdoppelt.
- Noch mehr Business-Themen findest du hier:
- „Warum haben Sie sich bei uns beworben?“ – 4 überzeugende Antworten
- Diese 3 Fragen solltest du auf jeden Fall im Bewerbungsgespräch stellen
- Lügen im Lebenslauf: Studie enthüllt die 5 beliebtesten Schwindeleien
Wie viel spart man durch das Ehegattensplitting wirklich?
Das Verfahren eignet sich vor allem für Paare, bei denen der eine Partner oder die eine Partnerin deutlich mehr verdient als der oder die andere. Die Höhe der steuerlichen Entlastung steigt nämlich proportional zum Verdienstgefälle zwischen den Ehepartner*innen. Je höher die Diskrepanz, desto höher ist auch der steuerliche Vorteil.
Katharina Wrohlich vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) schätzt den maximalen Steuervorteil durch das Ehegattensplitting auf circa 20.000 Euro pro Jahr. Das gilt jedoch erst ab einem zu versteuernden Jahreseinkommen in Höhe von mindestens 556.000 Euro.

Warum das Ehegattensplitting stark kritisiert wird
Über das Ehegattensplitting und seine Zukunft sind sich die Politiker*innen hierzulande jedoch unsicher. Während die Union die Regelung befürwortet, da das Ehegattensplitting zum Erhalt traditioneller familiärer Strukturen beiträgt und auch genau diese Familien schützen soll, sieht die SPD das anders.
Wiebke Esdar, stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion verrät gegenüber dem Handelsblatt, dass die aktuelle Regelung vor allem „Alleinverdiener-Ehen“ begünstige und „negative Erwerbsanreize für Frauen“ setze.
Und tatsächlich könnte das Aus des Ehegattensplittings dazu führen, dass die Arbeitsmarktbeteiligung von Frauen um 2,4 Prozentpunkte steigt. Bei Männern würde sie laut Erhebungen des DIW sogar um rund 0,3 Prozent zurückgehen. Gleichzeitig würden Frauen ihre Arbeitszeit im Durschnitt um 7,4 Prozent ausweite und Männer ihre um 1,5 Prozent reduzieren.
Fazit: Nicht immer lohnt sich eine Reform des Ehegattensplittings
Insbesondere für Frauen, die zuvor in Teilzeit tätig waren, könnte sich eine Ausweitung der Arbeitszeit ohne Ehegattensplitting lohnen. Andererseits wären Paare benachteiligt, deren Einkommen stark voneinander abweichen. Für das Jahr 2025 beträfe das circa 11,27 Mio. steuerpflichtige Doppelverdiener-Ehen.
Berechnungen der Vereinigten Lohnsteuerhilfe zufolge würde ein unverheiratetes Paar 548 Euro Steuern zahlen, wenn der oder die eine Partner*in 45.000 Euro und der oder die andere 15.000 Euro in Teilzeit im Jahr 2024 verdienen würde. Wären die beiden verheiratet, könnten sie im selben Jahr etwa 845 Euro Steuern sparen. Es bleibt demnach abzuwarten, ob es eine Reform des Ehegattensplittings geben wird und falls ja, wie diese aussehen wird.